Being Tagged:
Die digitale Neuordnung der Welt
Das Projekt
Being Tagged: Die digitale Neuordnung der Welt
RFID-Technik („Radio-Frequency Identification“, deutsch: „Funkerkennung“) bleibt in unserem Alltag häufig unsichtbar und doch ist sie fast überall: Die Chips finden sich u. a. in Ausweisen, Fahrzeugen, Kleidung, der Umwelt, in Tieren und manchmal auch in Menschen. Auf diesen Chips werden Informationen wie z. B. Produktionsdaten, Lieferketten und Preise, Namen, Geburtsdaten oder biometrische Merkmale gespeichert. Durchgesetzt hat sich in den vergangenen Jahren aber auch eine neue Technik, die es ermöglicht, RFID-Tags ohne Chips herzustellen und diese kostengünstig an fast jedem Objekt anzubringen.
Das zentrale Ziel dieses interdisziplinären Projekts zwischen Mediensoziologie, Science & Technology Studies (STS) und Elektrotechnik ist ein exploratives Gesamtbild der Chancen, Herausforderungen und Konfliktszenarien ubiquitärer chiploser RFID-Anwendungen zu erstellen. Relevante Verfahren, Infrastrukturen und Dynamiken von Wissensgenerierung und Weltaneignung sollen mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse, Expert:innen-Interviews und eines Zukunftsworkshops mit Vertreter:innen aus Wissenschaft, Industrie, Zivilgesellschaft und Science-Fiction-Autor: innen im Rahmen des Inventarisierungsdispositivs identifiziert werden.
Auf diese Weise sollen RFID-Systeme in ihrer sozialen Funktion und Wirkung als Teil eines umfassenderen Trends hin zu einer folgenreichen Verumweltlichung der Digitalisierung durch verknüpfte komplexe Systeme und technologische Infrastrukturen (vgl. u.a. Schröter 2015: 235f.; Frith 2019; Hayles 2009) erfasst werden. Eine großangelegte Inventarisierung der Welt bringt neue Formen der Wissensproduktion, -organisation und -strukturierung hervor, die sich deutlich auf unsere Wahrnehmung von Welt und Subjektivität auswirken. Deshalb gilt es, die Entwicklungen der neuen RFID-Technologie explorativ zu analysieren, um dadurch entstehende Chancen und Risiken frühzeitig zu identifizieren und im Hinblick auf politische, ökonomische und ethische Aspekte zu reflektieren. Da bisher keine Studien zur chiplosen RFID-Technologie im Bereich STS oder Technikfolgenabschätzung bekannt sind, will die Studie realistische Vorstellungen von Anwendungen und ihren Konsequenzen entwickeln, die über klassische logistische Visionen hinausgehen und die soziotechnischen und kulturellen Effekte der neuen Technologie aufzeigen.
Literatur:
Frith, Jordan: A Billion Little Pieces. RFID and lnfrastructures of ldentification. Cambridge/London: MIT press 2019.
Hayles, N. Katherine (2009): RFID. Human Agency and Meaning in Information-Intensive Environments. In: Theory, Culture & Society 26 (2-3), S. 47–72.
Schröter, Jens (2015): Das Internet der Dinge, die allgemeine Okologie und ihr Okonomisch-Unbewusstes. In: Christoph Engemann und Florian Sprenger (Hg.): Internet der Dinge. Uber smarte Objekte, intelligente Umgebungen und die technische Durchdringung der Welt. 1., Aufl. Bielefeld: transcript, S. 225–240.
Das Projektteam
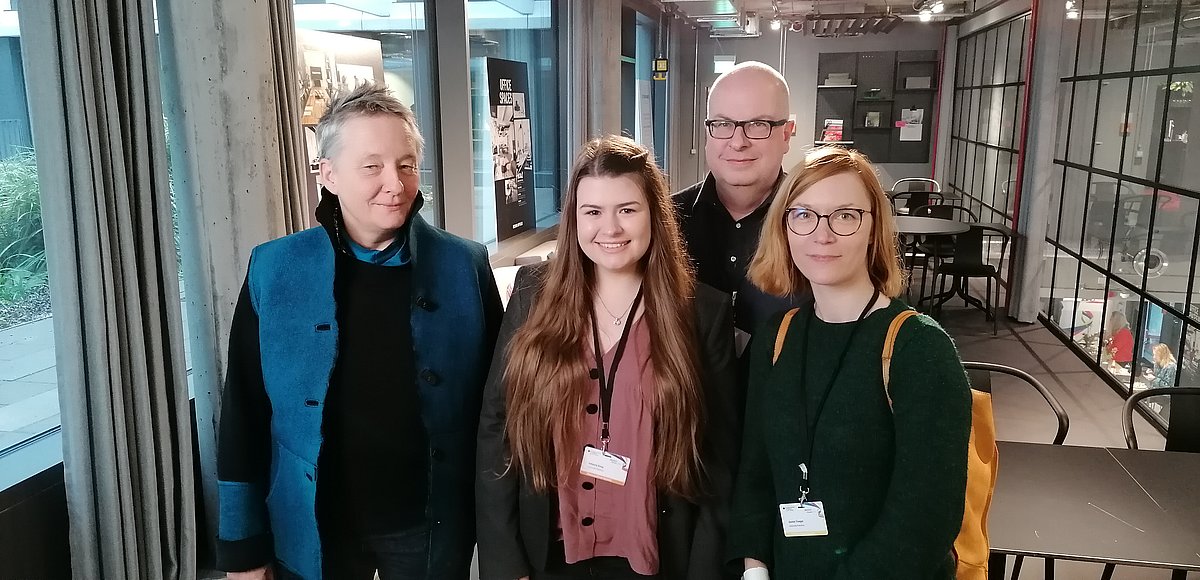
Jutta Weber ( jutta.weber@uni-paderborn.de ) ist Technikforscherin und leitet das Fachgebiet Mediensoziologie an der Universität Paderborn. Ihre Forschung analysiert die Verschränkung von menschlichen Praktiken und maschinellen Prozessen v.a. im Bereich Informatik, Künstliche Intelligenz und Robotik. Aktuell leitet sie neben dem BMBF Forschungsverbund ‚Ubitag‘ den BMBF-Forschungsverbund MEHUCO: ‚Meaningful Human Control. Autonome Waffensysteme zwischen Reflexion und Regulation‘ (2022-2026);www.mehuco.de
Ausgewählte Publikationen:
Anpassung oder ‘Öffentlicher Luxus’. Sozialökologische Transformation in Theorie und Social Science Fiction. In: Widerspruch 2024 (im Erscheinen)
Autonomous Drone Swarms and the Contested Imaginaries of Artificial Intelligence. Digi War (2024). https://doi.org/10.1057/s42984-023-00076-7
Planetarische Notlage: Über grünen Kapitalismus, die Revolution der letzten Generation und die Versuchungen protektionistischer Technokratie. In: esc medien kunst labor: Wüsten der Wirklichkeit. Jan. 2023; https://esc.mur.at/de/jahresprogramm/w%C3%BCste-der-wirklichkeiten
Datenbanken. In: Feministische Studien, Vol. 40 (2/2022), pp. 234-236.
Probably Approximately Correct. Epistemologische Grundlagen der Künstlichen Intelligenz. In: Orsolya Friedrich et al. (Hg.): Mensch-Maschine-Interaktion – Konzeptionelle, soziale und ethische Implikationen neuer Mensch-Technik-Verhältnisse. Paderborn 2022, 71-81.
Brave New Kachel World? Über Zoom-Booming, Datenkontrolle und öffentliche Infrastrukturen. In: Selin Gerlek, Sarah Kissler, Thorben Mämecke, Dennis Möbus (Hg.): Von Menschen und Maschinen
Mensch-Maschine-Interaktionen in digitalen Kulturen. Hagen: Hagen University Press 2022, 95-109; https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00002340/DK_Von_Menschen_und_Maschinen_2022.pdf
Jutta Weber, Daniel Erni und Jasmin Troeger, "ubiTag / 'Being Tagged': Die digitale Neuordnung der Welt – Chancen, Herausforderungen und Konfliktszenarien ubiquitärer chiploser RFID-Anwendungen," BMBF INSIGHT Forum 2022, Interdisziplinäre Perspektiven des gesellschaftlichen und technologischen Wandels, Talk & Poster, Dec. 5-6, Design Offices Berlin Humboldthafen, Berlin, Germany, Session: 'Themenoffenes Feld’, 2022.
Artificial Intelligence in the Age of Technoscience.“ In: Anthony Elliott (Hg.) Routledge Social Science Handbook of Artifical Intelligence. New York/London: Routledge, 2021, S. 58-73 (mit Bianca Prietl)
Human-Machine Learning und Digital Commons. In: Kathrin Braun/Cordula Kropp (Eds.): In digitaler Gesellschaft. Neukonfigurationen zwischen Robotern, Algorithmen und Usern. Bielefeld, Transcript. 2021; https://juttaweber.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/oa97838394545345e2h1FRnkmT9K-seiten-1-7133-135214-223.pdf
Technosecurity Cultures. Science as Culture, 29:1, 2020, hg. mit Katrin Kämpf;
Human-Machine Autonomies. In: Nehal Bhuta et al. (Eds.): Autonomous Weapon Systems. Cambridge 2016, 75-102 (mit Lucy Suchman);
Keep Adding. Kill Lists, Drone Warfare and the Politics of Databases. In: Environment and Planning D. Society and Space, Vol. 34(1) 2016, 107-125;
Blackboxing Organisms, Exploiting the Unpredictable. Control Paradigms in Human-Machine Translation. In: Martin Carrier, Alfred Nordmann (Hg.): Science in the Context of Application, Studies in the Philosophy of Science, Vol.274(6) 2011, S. 409-429.
Interdisziplinierung? Über den Wissenstransfer zwischen den Geistes-, Sozial- und Technowissenschaften. Bielefeld: transcript 2010, http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-1566-1/interdisziplinierung?c=91.
vgl. auch www.juttaweber.eu
Daniel Erni ( Daniel.erni.ate@mailbox.org ) leitet das Fachgebiet Allgemeine und Theoretische Elektrotechnik (ATE) an der Universität Duisburg-Essen. Er ist Mitbegründer des Spin-off-Unternehmens airCode in Duisburg, das an der Entwicklung flexibler, druckbarer RFID-Technologien arbeitet. Zu seinen aktuellen Forschungsinteressen gehören neben den chiplosen flexiblen RFIDs, die optische Verbindungstechnik höchster Bitraten, Nanophotonik, Plasmonik, hochempfindliche optische Biosensorik, neuartige Solarzellenkonzepte, optische und elektromagnetische Metamaterialien, Hochfrequenz-, mm-Wellen- und THz-Technik, biomedizinische Technik, Bioelektromagnetik, marine Elektromagnetik, computergestützte Elektrodynamik, numerische Multiskalen- und Multiphysik-Modellierung, numerische Strukturoptimierung sowie die Wissenschafts- und Technikforschung (STS). In der Fakultät für Ingenieurwissenschaften leitet er den Bachelor- und Masterstudiengang Medizintechnik.
Publikationen:
K. Neumann, D. Erni, and N. Benson, "Addressing the effects of UHF RFID tag crumpling," Int. Conference of Smart and Sustainable Technologies (SpliTech 2023), June 20-23, Hotel Elaphusa, Bol, Split, Croatia, 2023.
K.-D. Jenkel, B. Sievert, A. Rennings, M. Sakaki, D. Erni, and N. Benson, "Enhanced radar cross-section for W-band corner reflectors using ceramic additive manufacturing," 12th Annual IEEE Int. Conf. on RFID Technol. and Appl. (RFID-TA 2022), Sept. 12-14, Regina Margherita Conference & Leisure Hotel, Cagliari, Italy, Workshop Session S1_2: 'Flexible and Printable Electronics and Electromagnetics', pp. 1-3, 2022.
K. Jerbic, J. T. Svejda, B. Sievert, X. Liu, K. Kolpatzeck, M. Degen, A. Rennings, J. Balzer and D. Erni, "The identification of spectral signatures in randomized (sub-)surface material systems," 5th Int. Workshop on Mobile THz Systems (IWMTS 2022), July 4-6, University of Duisburg-Essen, Fraunhofer-inHaus-Center, Duisburg, Germany, Session 4: 'Terahertz Identification and Classification', 2022, (hybrid workshop as both, on-site and online event), doi: 10.1109/IWMTS54901.2022.9832449.
Z. Tian, R. He, H. Gao, M. Sakaki, N. Benson, P. Hildenhagen, D. Erni, and A. Rennings, "Design of a compact combline filter fabricated by lithography-based ceramic manufacturing (LCM)," 43rd Photonics and Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2022), hybrid/virtual conference including postponed PIERS 2021, April 25-29, Hangzhou, China, Session 3A16a – 'SC4: Microwave Integrated Passive Circuits and Devices', pp. 1-2, 2022.
K.-D. Jenkel, B. Sievert, A. Rennings, M. Sakaki, D. Erni, N. Benson, "Radar cross-section of ceramic corner reflectors in the W-band fabricated with the LCM-method," IEEE Trans. Antennas Propagat., 2023, (accepted).
Jasmin Troeger ( jasmin.troeger@uni-paderborn.de ) arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet der Mediensoziologie bei Prof. Dr. Jutta Weber. Aktuell befasst Sie sich im Projekt „Being Tagged‘: Die digitale Neuordnung der Welt“ (ubiTag), mit den Implikationen einer zunehmenden Inventarisierung von Welt durch den Einsatz chiploser ubiquitärer RFID-Anwendungen. Zudem befasst sie sich In Ihrer Dissertation aus medienwissenschaftlicher Perspektive an der Schnittstelle zwischen der STS und der CDS mit der prägenden Rolle von adaptiven, datengetriebenen Lernplattformen und damit einhergehend von automatisiert produzierten Daten, welche durch den Einsatz von algorithmengesteuerter Lernsoftware entstehen.
Sie studierte Kommunikations- und Medienwissenschaften am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. In ihren bisherigen Forschungsprojekten befasste sich Jasmin Troeger unter anderem mit Fragen aus den Bereichen der Medienverarbeitung und -wirkung sowie der Modellierung sozialer Identität durch Mediennutzung.
Forschungsschwerpunkte
- Neue Medien- und Kommunikationstechnologien
- Digitaler Wandel
- Datafizierungsprozesse
- Qualitative Forschungsmethoden der Kommunikations- und Medienwissenschaft
Ausgewählte Publikationen
Jutta Weber, Daniel Erni und Jasmin Troeger, "ubiTag / 'Being Tagged': Die digitale Neuordnung der Welt – Chancen, Herausforderungen und Konfliktszenarien ubiquitärer chiploser RFID-Anwendungen," BMBF INSIGHT Forum 2022, Interdisziplinäre Perspektiven des gesellschaftlichen und technologischen Wandels, Talk & Poster, Dec. 5-6, Design Offices Berlin Humboldthafen, Berlin, Germany, Session: 'Themenoffenes Feld’, 2022.
Troeger, J., Zacharova, I., Jarke, J., Macgilchrist, F. (2023). Digital ist besser!? - Wie Software das Verständnis von guter Schule neu definiert. In: Hrsg.: Breiter, A., Bock, A., Lange, A., Jarke, J. (2022) Datafied. Data for and in Education. Springer
Macgilchrist, F., Jornitz, S., Mayer, B., Troeger, J., (2023) Adaptive Lernsoftware oder adaptierende Lehrkräfte? Das Ringen um Handlungsspielräume. In: Hrsg.: Breiter, A., Bock, A., Lange, A., Jarke, J. (2022) Datafied. Data for and in Education. Springer
Troeger, J., Bock, A. (2022) The walkthrough – a methodological approach for platform (user) studies from a communication research perspective. Studies in Communication Sciences
Troeger, J., Lüpkes, J., & Bock, A. (2022). In software we (do not) trust. In Eckhardt Fuchs, Marcus Otto (Hg.): In Education We Trust? Vertrauen in Bildung und Bildungsmedien. Band 153. Göttingen: V&R unipress
Weich, A., Priedigkeit, M., Deny, P., & Troeger, J. (2021). Adaptive Lernsysteme zwischen Optimierung und Kritik: Eine Analyse der Medienkonstellationen bettermarks aus informatischer und medienwissenschaftlicher Perspektive. MedienPädagogik - Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, (44), 22-51. https://doi.org/10.21240/mpaed/44/2021.10.27.X
Troeger, J. & Tümler, J., (2020). Virtual Reality zur Steigerung empathischer Anteilnahme. In: Weyers, B., Lürig, C. & Zielasko, D. (Hrsg.), GI VR / AR Workshop. Gesellschaft für Informatik e.V.. DOI: https://doi.org/10.18420/vrar2020_3
- Johanna Knop (Universität Paderborn)
- Mariam Awwad (Universität Duisburg-Essen)
J. Weber, J. Troeger, and D. Erni, "ubiTag / 'Being Tagged': Die digitale Neuordnung der Welt – Chancen, Herausforderungen und Konfliktszenarien ubiquitärer chiploser RFID-Anwendungen," BMBF INSIGHT Forum 2022, Interdisziplinäre Perspektiven des gesellschaftlichen und technologischen Wandels, Talk and Poster, Dec. 5-6, Design Offices Berlin Humboldthafen, Berlin, Germany, Session: 'Themenoffenes Feld’, 2022.
J. Troeger, D. Erni, and J. Weber, "Tagging the whole world: Chipless RFID as a invisible, ubiquitous infrastructure of identification," STS Italia Conference (STS Italia 2023), June 28-30, University of Bologna, Bologna, Italy, 2023.
K. Neumann, D. Erni, and N. Benson, "Addressing the effects of UHF RFID tag crumpling," Int. Conference of Smart and Sustainable Technologies (SpliTech 2023), June 20-23, Hotel Elaphusa, Bol, Split, Croatia, 2023.
Meilensteine
Projektstart
Berlin: BMBF INSIGHT Forum 2022
Interdisziplinäre Perspektiven des gesellschaftlichen und technologischen Wandels, Talk and Poster
Virtuell: INSIGHT-Workshops 2023
Zwischenergebnisse und Verwertungskonzepte
Split, Croatia: Int. Conference of Smart and Sustainable Technologies (SpliTech 2023)
Bologna, Italien: STS Italia Conference
Università di Bologna, Bologna, Italia


